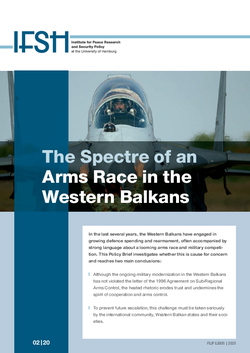Das Gespenst eines Wettrüstens im Westbalkan
Policy Brief 02|20
In den letzten Jahren haben die westlichen Balkanstaaten ihre Verteidigungsausgaben erhöht und ihre Rüstung ausgebaut, was oft mit deutlichen Äußerungen über einen drohenden Rüstungswettlauf und militärischen Wettbewerb einherging. Dieser Policy Brief untersucht, ob dies Anlass zur Sorge gibt, und kommt zu zwei wesentlichen Schlussfolgerungen:
- Obwohl die derzeitige militärische Modernisierung im Westbalkan nicht gegen den Wortlaut des Abkommens über subregionale Rüstungskontrolle von 1996 verstößt, untergräbt die hitzige Rhetorik das Vertrauen und den Geist der Zusammenarbeit und Rüstungskontrolle.
- Um eine künftige Eskalation zu verhindern, muss diese Herausforderung von der internationalen Gemeinschaft, den Westbalkanstaaten und ihren Gesellschaften ernst genommen werden.
Die Sicherheitslage im Westbalkan hat sich in letzter Zeit aufgrund erhöhter geopolitischer Spannungen, der Ermüdung der EU-Erweiterung und demokratischer Rückschritte verschlechtert. Trotz einiger positiver Entwicklungen bleibt Bosnien und Herzegowina instabil, und der Dialog zwischen Belgrad und Pristina befindet sich weiterhin in einer Sackgasse. Darüber hinaus haben alle westlichen Balkanstaaten ihre Verteidigungsbudgets erhöht und eine militärische Modernisierung eingeleitet. Gleichzeitig beschwören Politiker und Medien in der Region häufig das Schreckgespenst eines militärischen Wettstreits und eines Wettrüstens herauf. Dieser Policy Brief zeigt, dass zwar der Wortlaut des 1996 in Florenz unterzeichneten Abkommens über subregionale Rüstungskontrolle nach wie vor eingehalten wird, diese Entwicklungen jedoch bereits das Vertrauen in der Region untergraben haben. Wenn man sie ungehindert weiterlaufen lässt, könnten sie in Zukunft zu einer weiteren Eskalation führen.
Das Schreckgespenst eines Wettrüstens
Artikel IV von Anhang 1B des Dayton-Friedensabkommens diente als Grundlage für den Abschluss des Abkommens von Florenz von 1996. Das Abkommen, das sich am Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa (KSE-Vertrag) von 1990 orientierte, zielte darauf ab, durch obligatorische Reduzierungen in fünf Waffenkategorien – Kampfpanzer, gepanzerte Kampffahrzeuge, Artillerie, Kampfflugzeuge und Kampfhubschrauber – Transparenz, Vertrauen und ein stabiles militärisches Gleichgewicht zu erreichen. Das Abkommen führte auch Verifizierungsmechanismen wie Vor-Ort-Inspektionen und regelmäßigen Informationsaustausch ein. Unter der Leitung der OSZE setzten die westlichen Balkanstaaten das Abkommen vollständig um und übernahmen im
Januar 2015 die Verantwortung dafür.
Ende 2015 berichteten die Medien, dass Kroatien den Kauf des M270-Mehrfachraketenwerfersystems aus den USA in Erwägung ziehe, das Raketen mit einer Reichweite von bis zu 300 km transportieren kann. Serbien sah darin eine Bedrohung, die das militärische Gleichgewicht in der Region verschieben könnte, und erwog den Kauf des Raketensystems S-300 aus Russland. Obwohl letztlich keine dieser Waffen beschafft wurde, haben beide Staaten seitdem ihre militärische Modernisierung vorangetrieben. Sensationsberichte in den Medien und hitzige politische Rhetorik über das drohende Wettrüsten begleiteten jede neue Anschaffung.
„Jeder neue Kauf wurde von sensationslüsternen Medienberichten und hitzigen politischen Debatten über das drohende Wettrüsten begleitet.“
Die derzeitige Modernisierung des kroatischen Militärs ist durch den Wunsch motiviert, die Lücke zu den NATO-Richtlinien zu schließen, wonach mindestens 2 % des BIP für Verteidigung ausgegeben werden sollen. Obwohl kroatische Regierungsvertreter die Existenz eines Wettrüstens bestritten haben, haben die Medien häufig davor gewarnt. Die Pläne zur Modernisierung des Militärs im militärisch neutralen Serbien hingegen wurden durch die wachsende Besorgnis über mögliche Konflikte um die Republika Srpska und den Norden des Kosovo vorangetrieben. In Anlehnung an die serbischen Boulevardzeitungen, die regelmäßig das Schreckgespenst eines Wettrüstens heraufbeschwören, haben auch serbische Politiker diese Sprache verwendet. Zuletzt haben die USA Serbien wegen seiner Entscheidung, das russische Luftabwehrsystem Pantsir-S1 zu erwerben, mit Sanktionen gedroht. Präsident Vučić rechtfertigte den Kauf mit der Begründung, Serbien werde nicht zum „Bambi für die Schlachtbank“ werden, während Kroatien und Albanien aufrüsten.
Diese Entwicklungen haben in der gesamten Region Besorgnis ausgelöst. Am deutlichsten wurde dies im Kosovo, wo Politiker die Wiederaufrüstung Serbiens als weitere Rechtfertigung für die Umwandlung der Kosovo-Sicherheitskräfte in die Kosovo-Streitkräfte nutzten. Serbien bezeichnete dies als „die unmittelbarste Bedrohung für Frieden und Stabilität in der Region” und schloss eine militärische Intervention nicht aus, falls die neuen Streitkräfte im serbisch besiedelten Norden eingesetzt werden sollten. Für russische Beamte ist die Schaffung der neuen Streitkräfte auf einem Gebiet, das ihrer Ansicht nach zu einem der Unterzeichnerstaaten (d. h. Serbien) gehört, ein Verstoß gegen das Abkommen von Florenz.
Militärischer Aufbau in Zahlen
Während die Militärausgaben der westlichen Balkanstaaten als Prozentsatz ihres BIP zwischen 2014 und 2018 leicht zurückgingen, stiegen sie in absoluten Zahlen aufgrund des BIP-Wachstums stetig an. Im Jahr 2019 stiegen die Verteidigungsbudgets in der gesamten Region sprunghaft an – um 9,8 % in Albanien, 14 % in Montenegro, 20,3 % in Kroatien, 27,7 % in Nordmazedonien und 35 % in Serbien. All dies hat es diesen Staaten ermöglicht, mehr in die Modernisierung ihres Militärs zu investieren, obwohl sie alle weiterhin hinter der NATO-Richtlinie zurückbleiben, mindestens 20 % der Verteidigungsausgaben für Ausrüstung aufzuwenden.
Serbien hat den Großteil seiner neuen Waffen aus Russland bezogen, darunter Jets (Mig 29), Hubschrauber (Mi-17V-5 und Mi-35M) und Luftabwehrsysteme (Pantsir-S1). Kroatien hat neue Waffen aus den USA und von seinen NATO-Verbündeten erhalten, darunter gepanzerte Fahrzeuge (MRAP), Hubschrauber (Kiowa, Black Hawk) und Artilleriegeschütze (Panzerhaubitzen 2000). Andere Staaten in der Region sind diesem Beispiel gefolgt und haben ihre militärische Modernisierung vorangetrieben. Dies hat den Eindruck eines bevorstehenden Stellvertreter-Wettrüstens erweckt. Wie die nachstehende Tabelle zeigt, hat jedoch weder die Quantität noch die Qualität der beschafften Waffen bisher das militärische Gleichgewicht beeinträchtigt, da alle konventionellen Streitkräfte weiterhin unter den im Abkommen von Florenz festgelegten Grenzen liegen.
„Weder die Quantität noch die Qualität der beschafften Waffen hat bislang das militärische Gleichgewicht beeinträchtigt.“
Schlussfolgerung und Empfehlungen
Die derzeitige militärische Modernisierung in der Region hat zwar bislang nicht gegen den Wortlaut des Abkommens von Florenz verstoßen, doch die hitzige Rhetorik über ein Wettrüsten und militärischen Wettbewerb verstößt gegen dessen Geist. Wenn das gegenseitige Vertrauen weiter schwindet, droht das Schreckgespenst eines Wettrüstens von der Rhetorik zur Realität zu werden. Um eine künftige Eskalation zu vermeiden, sind mehrere Schritte erforderlich.
Erstens sollten die westlichen Balkanstaaten die Transparenz ihrer militärischen Modernisierungspläne und Beschaffungen sowie deren Kosten verbessern. Zweitens sollten Politiker und Medien in den westlichen Balkanstaaten von hetzerischer Rhetorik Abstand nehmen, die das Vertrauen untergräbt, Spannungen schürt und Sicherheitsdilemmata hervorruft. Drittens sollte die OSZE die Parteien dazu ermutigen, Gespräche über eine Überarbeitung und Aktualisierung des Abkommens von Florenz aufzunehmen, um dessen Lücken in Bezug auf neue Waffenkategorien (wie Drohnen), den qualitativen Aspekt des militärischen Gleichgewichts, das Fehlen von Konsultationsmechanismen zu militärischen Modernisierungsplänen und die Schaffung der Kosovo-Streitkräfte zu schließen. Viertens sollte die OSZE den Aufbau ziviler Fachkompetenz im Bereich der Rüstungskontrolle im Westbalkan unterstützen. Fünftens sollten die OSZE-Teilnehmerstaaten davon absehen, den Staaten des westlichen Balkans Waffen zu liefern, die das militärische Gleichgewicht in der Region verschieben könnten. Sechstens sollte die EU die militärische Modernisierung überwachen und die Beitrittsverhandlungen nutzen, um den militärischen Wettbewerb in der Region zu entschärfen. Siebtens sollte die NATO ihre Erwartungen hinsichtlich erhöhter Verteidigungsausgaben im westlichen Balkan mit legitimen Bedenken hinsichtlich der militärischen Stabilität und der Rüstungskontrolle in Einklang bringen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Schreckgespenst eines Wettrüstens im Westbalkan zwar noch immer nur rhetorischer Natur ist, dies jedoch kein Grund zur Selbstzufriedenheit ist. Die Sprache des militärischen Wettstreits untergräbt das Vertrauen und schürt Ängste, die zwei Jahrzehnte Friedensarbeit in dieser nach wie vor instabilen Ecke Europas leicht zunichte machen könnten.
Dieses Strategiepapier ist Teil des Projekts „Western Balkans Military Dynamics” des Netzwerks von Thinktanks und akademischen Einrichtungen der OSZE (www.osce-network.net). Das Projekt wurde von der Fakultät für Politikwissenschaft der Universität Belgrad durchgeführt und vom österreichischen Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten sowie vom Auswärtigen Amt der Bundesrepublik Deutschland finanziert.
Literatur
European Western Balkans, „Waffenbeschaffung und militärische Neutralität: Wohin steuert Serbiens Verteidigungspolitik?“ 10.1.2020. https://t1p.de/ye5c.
Guardian, „Serbien spricht von bewaffneter Intervention, während Kosovo neue Armee genehmigt“, 14.12.2018. https://t1p.de/7p2q.
Sputnik, „Moskau hält die Schaffung einer kosovarischen Armee für unverantwortlich“, 3.4.2017. https://t1p.de/7zql.
SIPRI-Datenbank zu Militärausgaben, https://www.sipri.org/databases/milex.